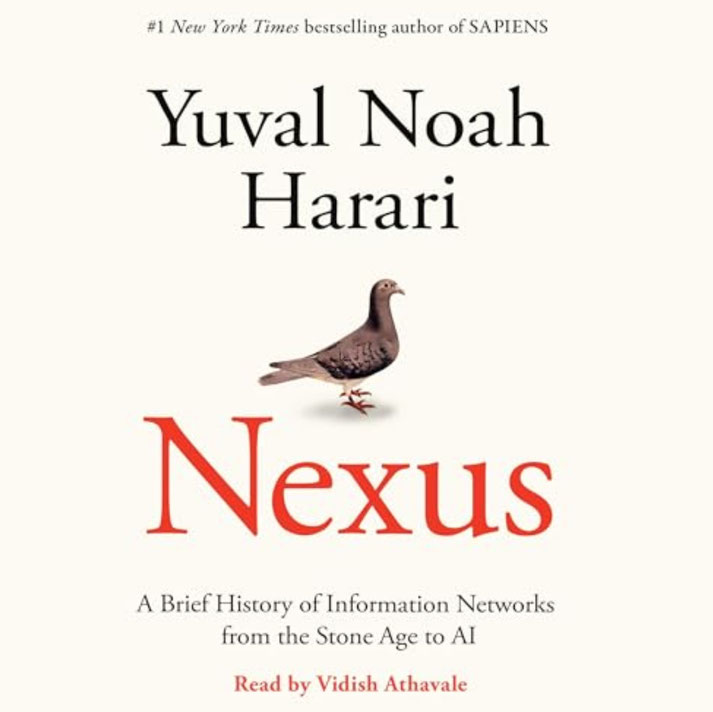
Yuval Noah Hararis Buch „Nexus – Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz“ ist eine weitgespannte historische und politische Analyse, die den roten Faden der Menschheitsgeschichte in der Entwicklung und Wirkung von Informationsnetzwerken erkennt.
Harari beginnt mit der grundlegenden Feststellung, dass Information nicht bloss ein Abbild der Realität ist, sondern eine verbindende Kraft: Sie schafft Netzwerke, die weit über das Individuum hinausreichen. Schon in frühen Jäger- und Sammler-gesellschaften waren Mythen, Geschichten und gemeinsame Symbole das Bindemittel, das grosse Gruppen zu koordinierter Zusammenarbeit befähigte. Religion, Nationen und Geld sind für Harari Paradebeispiele solcher „intersubjektiven Realitäten“ – Konstrukte, die nur existieren, weil viele Menschen gemeinsam an sie glauben.
Mit der Erfindung der Schrift wurde Information dauerhaft fixierbar. Dies eröffnete ungeahnte Möglichkeiten für Verwaltung, Handel und staatliche Organisation – schuf aber auch ein neues Spannungsverhältnis zwischen Wahrheit und Ordnung. Bürokratische Systeme, so Harari, sind effizient im Verwalten, neigen jedoch dazu, Komplexität zu reduzieren und unangenehme Wahrheiten auszublenden.
Erst mit der Etablierung der modernen Wissenschaft entstand ein institutionalisierter Mechanismus zur Selbstkorrektur, der sich systematisch gegen Fehler und Falschannahmen wendet. Harari stellt diesem Modell der offenen, feedback-orientierten Wissensproduktion den totalitären Zentralismus gegenüber: Während Demokratie und Wissenschaft Macht und Information dezentralisieren, setzen autokratische Systeme auf Kontrolle und Informationsmonopole – mit kurzfristigen Effizienzgewinnen, aber langfristiger Anpassungsunfähigkeit.
Im zweiten Teil richtet Harari den Blick auf ein neues Phänomen: das „anorganische Netzwerk“. Computer und Algorithmen sind nicht mehr nur passive Übertra-gungsmedien menschlicher Information, sondern selbst aktive Knotenpunkte, die Daten verarbeiten, interpretieren und in eigene Handlungsmuster umsetzen.
Damit verändert sich die Natur des Netzwerks radikal: Maschinen können ohne Pause überwachen, selektieren und Entscheidungen vorbereiten. Harari warnt vor der Zieloptimierung solcher Systeme, wenn ihre Parameter falsch gesetzt sind – etwa wenn soziale Plattformen Interaktionen nach „Engagement“ bewerten und damit unabsichtlich Polarisierung und Hetze verstärken.
Der dritte Teil widmet sich den politischen Konsequenzen der KI-Revolution. Harari sieht die Demokratie in einer prekären Lage: Algorithmen sind in der Lage, öffentliche Diskurse zu manipulieren, fragmentieren und für verdeckte Interessen nutzbar zu machen.
Besonders gefährlich sei das Potenzial zur Entstehung algorithmischer Totalitarismen – Systeme, in denen die Kontrolle über Information so umfassend und effizient ist, dass selbst historische Diktaturen verblassen. Zugleich besteht das Risiko, dass KI sich verselbständigt und auch von den Mächtigen nicht mehr vollständig beherrscht werden kann.
Harari skizziert ein Szenario globaler Fragmentierung – eines „Silicon Curtain“ – in dem sich die Welt entlang technologischer Ökosysteme, etwa zwischen westlichen und chinesischen Plattformwelten, aufspaltet.
Abschließend formuliert Harari Leitprinzipien für eine gerechte Informationspolitik im KI-Zeitalter: Datenverarbeitung müsse dem Wohl der Menschen dienen, nicht ihrer Manipulation; Macht in Netzwerken solle dezentral verteilt und durch kontinuierliche Selbstkorrektur kontrolliert werden; Algorithmen müssten erklärbar, transparent und rechenschaftspflichtig sein.
„Nexus“ ist dabei kein Handbuch mit fertigen Lösungen, sondern ein Weckruf, der historische Perspektive und aktuelle Krisendiagnose verbindet. Hararis zentrale Botschaft lautet: Informationsnetzwerke haben die Menschheit gross gemacht – doch wenn wir nicht lernen, sie mit Weisheit zu gestalten, werden sie uns formen, bis wir uns selbst verlieren.
Hararis Darstellung westlicher Institutionen als selbstkorrigierende Netzwerke ist sicherlich zu idealistisch. Auch Demokratien sind anfällig für Desinformation, Lobbyismus und wirtschaftliche Einflussnahme. Die Rolle von „Fake News“ und gezielter Manipulation in westlichen Gesellschaften zeigt, dass die Selbstkorrektur nicht immer funktioniert. Hararis Vertrauen in die demokratische Resilienz erscheint daher als optimistisch, wenn man die realen Machtstrukturen und ökonomischen Interessen berücksichtigt.
Harari sieht die liberale Demokratie in einer existenziellen Krise, ausgelöst durch die rasante Entwicklung von Informationsnetzwerken und künstlicher Intelligenz. Während demokratische Systeme historisch durch ihre Fähigkeit zur Selbstkorrektur und pluralistischen Informationsverarbeitung erfolgreich waren, drohen diese Stärken durch zentralisierte, algorithmisch gesteuerte Netzwerke untergraben zu werden. Die Zukunft der Demokratie hängt laut Harari davon ab, ob es gelingt, technologische Macht politisch zu kontrollieren, ethisch zu gestalten und transparent zu machen.

Kommentar schreiben